Die Kosten für den Betrieb des Staates sind auf den ersten Blick überwältigend. In Frankreich zum Beispiel wird ein erheblicher Teil des Haushalts für den Betrieb des politischen Systems aufgewendet. Im Jahr 2020 wurden rund 1,8 Milliarden Euro für das Funktionieren des Staates veranschlagt, wobei sich dieser Betrag auf eine Vielzahl von Institutionen und deren Personal verteilt. Die größte Summe, rund 518 Millionen Euro, geht an die Nationalversammlung, gefolgt von 324 Millionen Euro für den Senat und weiteren 35 Millionen Euro für den parlamentarischen Fernsehsender. Auch die Präsidentschaft und andere staatliche Funktionen wie der Verfassungsrat und der Gerichtshof der Französischen Republik erhalten Zuweisungen, die insgesamt einen erheblichen Betrag ausmachen. Wenn man zudem die Kosten für die Verwaltung und den Betrieb der Ministerien hinzuzieht, summiert sich der jährliche Etat auf fast 1,8 Milliarden Euro.
Dieses Geld wird größtenteils für die Bezahlung der gewählten Politiker, ihrer Berater und die Verwaltung des Staates verwendet. Es bleibt jedoch nur ein kleiner Teil für die tatsächliche Förderung der demokratischen Prozesse und die Stärkung der Teilhabe der Bürger an den politischen Entscheidungen. In Frankreich macht die öffentliche Finanzierung von Demokratie lediglich rund 34 Euro pro Jahr und Kopf aus – ein Bruchteil des gesamten Staatshaushalts und der für politische Verwaltung vorgesehenen Mittel.
Es stellt sich die Frage: Ist es nicht gerecht, wenn ein kleiner Teil der Staatsmittel für die Finanzierung des demokratischen Entscheidungsprozesses aufgewendet wird? In einer Demokratie sollte es die Aufgabe des Staates sein, sicherzustellen, dass jeder Bürger gleichermaßen Einfluss auf die Wahl der politischen Vertreter nehmen kann. Das bedeutet auch, dass öffentliche Mittel für politische Parteien, Wahlkämpfe und die politische Meinungsbildung bereitgestellt werden müssen. Die Höhe dieser Mittel sollte jedoch in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, sodass private Gelder keine übermäßige Macht über das politische System ausüben.
Dieser Gedanke ist nicht neu. Im Gegenteil, er ist ein zentraler Bestandteil der Demokratietheorie. Öffentliche Mittel für politische Parteien und Wahlkämpfe dienen nicht nur dazu, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, sondern auch, die Demokratie vor den Gefahren des Missbrauchs durch private Interessen zu schützen. Wenn private Spenden und Lobbyeinflüsse den politischen Diskurs dominieren, entstehen Ungleichgewichte, die den demokratischen Prozess gefährden.
Doch diese Frage ist nicht nur für Frankreich relevant. Vielmehr müssen wir uns auch mit den Auswirkungen privater Gelder auf die Demokratie in anderen Ländern auseinandersetzen. Die USA sind ein Beispiel dafür, wie die zunehmende Rolle privater Gelder die politische Landschaft verzerrt hat. Dort hat die Abschaffung öffentlicher Mittel zugunsten privater Spenden zu einer Situation geführt, in der politische Entscheidungen zunehmend durch die Interessen einer wohlhabenden Minderheit beeinflusst werden. Diese Entwicklung stellt eine ernsthafte Gefahr für das demokratische Prinzip der Gleichheit und Teilhabe dar.
In Europa sind ähnliche Tendenzen zu beobachten. Auch in Ländern wie Italien, Kanada und Frankreich gibt es Bestrebungen, die öffentliche Finanzierung von Demokratie abzubauen. In Frankreich zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass sich die politische Landschaft zunehmend von traditionellen Parteien entfernt, die in der Vergangenheit von öffentlichen Mitteln profitierten. Neue politische Bewegungen wie „La République en Marche“ oder „La France Insoumise“ präsentieren sich als Anti-Parteien, die den traditionellen politischen Strukturen den Rücken kehren. Dies führt zu einer Entfremdung der Bürger von den etablierten politischen Institutionen und verschärft die Diskrepanz zwischen der politischen Elite und den einfachen Bürgern.
Die Frage, wie sich diese Entwicklungen auf die Demokratie auswirken, ist komplex. Einerseits gibt es eine wachsende Skepsis gegenüber den etablierten Parteien und ihrer Nutzung öffentlicher Mittel. Andererseits stellt sich die Frage, wie die Demokratie aufrechterhalten werden kann, wenn öffentliche Mittel immer weiter eingeschränkt werden. Wenn die Finanzierung der Demokratie von privaten Geldern abhängt, steigt das Risiko von Korruption und der politischen Einflussnahme durch reiche Einzelpersonen oder Lobbygruppen.
Was bedeutet dies für die Zukunft der Demokratie in Europa? Es besteht die Gefahr, dass das Beispiel der USA Schule macht und auch in Europa der Einfluss von privatem Kapital in den politischen Prozess immer weiter zunimmt. Dies könnte zu einer Aushöhlung der Demokratie führen, bei der die politischen Entscheidungen zunehmend von einer kleinen Elite und nicht mehr von den Bürgern getroffen werden. Die Vorstellung, dass politische Parteien und Wahlkämpfe nur durch öffentliche Gelder finanziert werden, könnte bald als veraltetes Modell betrachtet werden.
Wichtig zu erkennen ist, dass Demokratie mit Kosten verbunden ist. Die Ausgaben für Wahlkämpfe, politische Parteien und die Struktur des politischen Systems sind notwendig, um die Funktionsfähigkeit einer Demokratie zu gewährleisten. Wenn diese Kosten nicht durch öffentliche Mittel gedeckt werden, wird das System anfällig für private Einflussnahme. Deshalb ist es entscheidend, dass wir uns bewusst machen, wie diese Dynamik das Vertrauen der Bürger in ihre politischen Institutionen beeinflusst und wie wir sicherstellen können, dass die Demokratie nicht von privaten Interessen korrumpiert wird.
Um eine gesunde Demokratie zu erhalten, ist es unerlässlich, dass die Finanzierung dieser Demokratie öffentlich und transparent bleibt. Es geht darum, das Vertrauen der Bürger in das politische System wiederherzustellen und sicherzustellen, dass politische Entscheidungen im Interesse der gesamten Bevölkerung und nicht nur einer privilegierten Minderheit getroffen werden.
Der Einfluss des Geldes auf die amerikanische Politik: Wie die Superreichen die Parteien dominieren
In der heutigen politischen Landschaft der USA ist das Bild, das sich uns von den Parteien und ihren Unterstützern bietet, von einer bemerkenswerten Konzentration des Reichtums geprägt. Nicht nur die Republikaner, sondern auch die Demokraten haben sich zunehmend von den finanziellen Interessen der Superreichen abhängig gemacht. Diese Entwicklung hat das politische System in den Vereinigten Staaten tiefgreifend verändert und stellt sowohl für die Parteien als auch für die Demokratie selbst eine Herausforderung dar.
Die Zeiten, in denen die politische Landschaft von breiten gesellschaftlichen Bewegungen und einer Vielzahl von Unterstützern geprägt war, sind längst vorbei. In der Nachkriegszeit gab es noch ernsthafte Diskussionen über die Existenz von Massenparteien und deren Überlebensfähigkeit. Maurice Duverger, ein berühmter politischer Wissenschaftler, zog damals eine klare Trennung zwischen den massenorientierten Parteien, wie sie in Deutschland existierten, und den kaderorientierten Parteien, die in Frankreich dominierend waren. Heutzutage sind diese Kategorien nicht mehr ausreichend. Es ist vielmehr von "gefangenen Parteien" die Rede, deren primäre Ressource nicht mehr die Unterstützung breiter Wählermassen ist, sondern die Geldmittel einer winzigen, aber sehr wohlhabenden Elite.
Die Republikanische Partei in den USA ist ein Paradebeispiel für diese Entwicklung. Die Koch-Brüder und andere ultrareiche Unterstützer haben in den letzten Jahrzehnten eine Schlüsselrolle in der Finanzierung der Partei übernommen. Die Folge dieser finanziellen Abhängigkeit war, dass die republikanischen Kandidaten und ihre politischen Botschaften zunehmend den Interessen einer kleinen Gruppe von Superreichen dienten und immer weniger den Bedürfnissen der breiten Wählerschaft entsprachen. Die Wahl von Mitt Romney als Präsidentschaftskandidat im Jahr 2012 spiegelt diese Entwicklung wider: Statt den besten Kandidaten oder die besten politischen Ideen zu wählen, setzte die Partei auf den Kandidaten des Geldes, was schließlich zu einer massiven Entfremdung von den traditionellen Wählern führte. Die finanziellen Interessen der wenigen Großspender dominierten den Wahlkampf und prägten die politische Ausrichtung der Republikaner auf eine Weise, die für viele Wähler unerträglich wurde.
Dieser Einfluss des Geldes erstreckt sich weit über die Wahlkampffinanzierung hinaus. Die Koch-Brüder und ähnliche Akteure haben nicht nur die Kandidatenaufstellung beeinflusst, sondern auch die Art und Weise, wie Wahlen geführt werden. Die Nutzung von privaten Daten zur gezielten Ansprache von Wählern, auch als Microtargeting bekannt, hat den Republikanern geholfen, Wahlen zu gewinnen. Allerdings war dieser Erfolg auch mit einer enormen politischen Abhängigkeit verbunden. Die Republikaner konnten es sich nicht leisten, die Unterstützung der Superreichen zu verlieren, da die aktuellen Regeln für Wahlkampffinanzierung es fast unmöglich machen, ohne diese finanziellen Mittel erfolgreich zu kandidieren.
Donald Trump stellte eine Ausnahme dar. Dank seines eigenen Vermögens war er in der Lage, sich von den Fängen der Koch-Brüder zu befreien und einen Großteil seiner Wahlkampffinanzierung selbst zu übernehmen. Dies verschaffte ihm eine gewisse Unabhängigkeit, obwohl er sich in vielerlei Hinsicht ebenso in die Abhängigkeit von anderen wohlhabenden Kreisen begab.
Die Demokratische Partei steht vor einer ähnlichen Herausforderung. Obwohl sie nicht von einer einzelnen, so mächtigen Organisation wie den Koch-Brüdern dominiert wird, hat sie ebenfalls starke finanzielle Unterstützer, deren Interessen oft im Widerspruch zu denen der breiten Wählerschaft stehen. Viele der Großspender der Demokraten, insbesondere aus den Kreisen von Wall Street und Silicon Valley, sind sozial liberal, aber wirtschaftlich äußerst konservativ. Sie setzen sich für Themen wie gleichgeschlechtliche Ehe und den Schutz des Abtrechtsrechts ein, lehnen jedoch Steuererhöhungen ab, die für die Finanzierung sozialer Programme erforderlich wären. Diese Haltung widerspricht den Interessen der traditionellen demokratischen Wählerschaft, die vor allem aus den arbeitenden Klassen und Gewerkschaften besteht. Die Auswirkungen dieser finanziellen Bindungen wurden besonders bei der Wahl von Hillary Clinton 2016 deutlich. Ihre Nähe zu den Finanzkreisen und ihre Ablehnung populistischer wirtschaftlicher Maßnahmen trugen wesentlich zu ihrer Niederlage bei. Der überraschende Erfolg von Bernie Sanders im Vorfeld der Wahl spiegelte dagegen den Wunsch vieler Wähler wider, zu den historischen Werten der Partei zurückzukehren.
Barack Obama, der selbst als "Verfechter des Wandels" in die Geschichte einging, spielte in dieser Entwicklung eine bedeutende Rolle. Während seiner Präsidentschaft sammelte er enorme Summen für seine Wahlkämpfe und legte dabei den Grundstein für die weitere Konzentration von Reichtum und Macht in der politischen Landschaft. Wie eine Analyse des Washington Post zeigt, veranstaltete Obama während seiner ersten Amtszeit mehr Fundraising-Events als jeder andere Präsident vor ihm. Dabei fand das Fundraising vor allem unter wohlhabenden Kreisen statt und trug zur Kluft zwischen der Demokratischen Partei und den Arbeitermassen bei. Diese finanzielle Abhängigkeit hatte nicht nur Auswirkungen auf die Wahlkampfstrategien, sondern auch auf die politischen Entscheidungen von Obama, die oft eher wirtschaftlich konservativ als progressiv waren.
Insgesamt zeigt sich, dass sowohl die Republikaner als auch die Demokraten in den USA zunehmend von einer winzigen Elite finanziell abhängig sind. Diese Entwicklung hat weitreichende Konsequenzen für das politische System und die Demokratie in den Vereinigten Staaten. Sie führt zu einer zunehmenden Entfremdung der Wählerschaft von den etablierten Parteien und verstärkt das Gefühl, dass das politische System von den Interessen einer kleinen, wohlhabenden Klasse kontrolliert wird.
Es ist von zentraler Bedeutung, dass dieser Trend nicht nur in den USA beobachtet wird, sondern auch in Europa und anderen Teilen der Welt zunehmend zu einem Thema wird. Die Frage, wie Demokratie in einer Welt bestehen kann, in der das Geld so viel Macht über politische Prozesse hat, bleibt ein ungelöstes Problem. Während es in den USA bereits eine zunehmende Kluft zwischen den politischen Parteien und der Bevölkerung gibt, könnte dieser Trend auch andere Demokratien betreffen, wenn nicht bald grundlegende Reformen vorgenommen werden.
Wie öffentlicher Finanzierungsmechanismus die Demokratie stärken kann: Ein Blick auf die politische Finanzierung und die Herausforderungen der Wahlkampfinfrastruktur
Ein zentraler Aspekt der demokratischen Legitimation ist die Finanzierung von Wahlkämpfen und politischen Bewegungen. Die zunehmende Dominanz von privaten Geldmitteln hat die Frage aufgeworfen, wie demokratische Prozesse durch systematische Reformen verändert werden können, um eine größere Chancengleichheit zwischen den Kandidaten zu gewährleisten. Eine der grundlegenden Überlegungen hierzu ist, wie die Finanzierung von Wahlkampagnen auf eine transparentere, gerechtere und demokratischere Grundlage gestellt werden kann. In dieser Hinsicht könnten staatlich organisierte Finanzierungsmodelle, wie etwa ein "Democracy Bank" oder die Einführung von "Democratic Equality Vouchers" (DEVs), einen bedeutenden Schritt in die richtige Richtung darstellen.
Das Konzept einer „Democracy Bank“, bei dem der Staat die Wahlkampfkostenerstattung direkt an die Kandidaten übernimmt, könnte den Einfluss des privaten Kapitals auf die politische Bühne erheblich verringern. Ein solcher Mechanismus würde es ermöglichen, dass jeder Kandidat, unabhängig von seiner finanziellen Ausgangslage, die gleichen finanziellen Mittel für seine Kampagne erhält. Das Risiko für den Staat wäre dabei relativ gering, da nur diejenigen Kandidaten, die weniger als fünf Prozent der Wählerstimmen erhalten, die Gelder nicht zurückzahlen müssten. Diese Idee geht davon aus, dass Wahlkämpfe mit einer Fairness und Transparenz gestaltet werden können, die den aktuellen Mängeln des Systems entgegenwirken.
Ein weiteres relevantes Konzept ist die Einführung von „Democratic Equality Vouchers“ (DEVs), die jedem Wähler eine Art Gutschein für die Wahlkampffinanzierung zur Verfügung stellen. Auf nationaler Ebene könnten diese DEVs politische Bewegungen oder Parteien finanzieren, während auf lokaler Ebene jeder Wähler mit einem DEV die Möglichkeit hätte, seine bevorzugte Wahlkampfkampagne zu unterstützen. Hierbei könnte die Höhe des DEVs proportional zu der Anzahl der Wähler und den Rückerstattungen für Wahlkampfkosten sein. Um eine unnötige Explosion der Anzahl von Kandidaten zu verhindern, wäre es erforderlich, dass nur diejenigen Kandidaten, die eine Mindestanzahl an DEVs erhalten, weiterhin von diesen Mitteln profitieren. Dies würde sicherstellen, dass nur diejenigen Kandidaten, die tatsächlich Unterstützung aus der breiten Bevölkerung erfahren, sich in den Wahlkampf stürzen können.
Ein weiterer relevanter Punkt ist die grundlegende Überlegung, wer überhaupt als Kandidat aufgestellt werden kann. Derzeit ist die Antwort darauf oft schlichtweg „jeder“, was jedoch nicht der Realität entspricht. In vielen Fällen haben potenzielle Kandidaten nicht die finanziellen Mittel, um eine Wahlkampagne zu führen, selbst wenn sie die notwendigen Qualifikationen besitzen. Ein funktionierendes demokratisches System braucht genügend Kandidaten, um eine echte Wahl zu ermöglichen. Doch es gibt keine einfache mathematische Lösung für dieses Problem. Es erfordert eine kollektive Auseinandersetzung und einen intensiven Dialog über die Rahmenbedingungen, die einen echten Wettbewerb ermöglichen.
In diesem Zusammenhang könnte die Vorstellung, dass die Kandidaten, die am meisten Geld ausgeben, auch automatisch gewinnen, in vielerlei Hinsicht als falsch betrachtet werden. Es ist vielmehr eine statistische Regel, dass bei gleichen Bedingungen der Kandidat, der am meisten ausgibt, tendenziell auch die meisten Stimmen erhält. Die Präsenz privater finanzieller Interessen in politischen Wahlkämpfen beeinflusst die Ergebnisse mehr als die demokratische Gleichheit des „ein Bürger, eine Stimme“-Prinzips.
Die Wichtigkeit dieser Diskussion wird besonders in einem Umfeld betont, in dem der demokratische Wettbewerb zunehmend durch technokratische und wirtschaftlich orientierte Diskurse ersetzt wird. In Frankreich beispielsweise ist es unter der Macron-Regierung erkennbar, dass die politische Konkurrenz durch eine einseitige Betonung von Expertise und ökonomischem Rationalismus eingeschränkt wird. Diese Art von technokratischem Denken, das politische Differenzen nicht als legitim anerkennt, sondern als etwas behandelt, das überwunden werden muss, führt zu einer Verringerung der pluralistischen und offenen politischen Debatten. In solchen Systemen, in denen politische Differenzen als irrelevant oder obsolet gelten, wird die Frage der sozialen und ökonomischen Gerechtigkeit marginalisiert.
Tatsächlich ist es die Art und Weise, wie politische Institutionen und das wirtschaftliche System gestaltet sind, die diese scheinbar unumstößlichen "globalen" Zwänge schaffen. In der aktuellen politischen Debatte wird zu oft vergessen, dass die ökonomischen Rahmenbedingungen nicht objektiv vorgegeben sind, sondern durch politische Entscheidungen geformt werden. Insofern ist es nicht nur eine technische Frage, wie ökonomische Herausforderungen bewältigt werden, sondern auch eine politische. Der Glaube, dass es keine alternativen Modelle zur bestehenden Wirtschaftsordnung gibt, ist ein verhängnisvoller Mythos.
Die Bedeutung einer offenen und pluralistischen politischen Debatte kann nicht genug betont werden. Gerade in Zeiten von Krisen und wachsender politischer Unsicherheit, in denen technokratische Modelle und die Konzentration von Macht in den Händen einer kleinen Elite vorherrschen, ist es entscheidend, dass unterschiedliche Perspektiven Gehör finden. Dies könnte durch die Förderung von transparenten, öffentlichen und gerechteren Finanzierungsmöglichkeiten für Wahlkämpfe und politische Bewegungen erreicht werden. Der Weg zu einer wirklich demokratischen Gesellschaft erfordert nicht nur die Anerkennung politischer Differenzen, sondern auch die Fähigkeit, diese Differenzen in einem offenen, respektvollen Dialog auszutragen, ohne dass finanzielle Ungleichgewichte die politische Teilhabe der Bürger übermäßig beeinflussen.
Warum die Arbeiterklasse in politischen Institutionen nicht vertreten ist: Eine Analyse der ungleichen Repräsentation
In Frankreich sind Arbeiter in der Nationalversammlung heute praktisch unsichtbar. Sie machen weniger als 2,5 Prozent der Abgeordneten aus, obwohl sie in der Gesamtbevölkerung rund 27,4 Prozent repräsentieren. Die Mehrheit der Abgeordneten gehört eher zur akademischen Elite und ist deutlich häufiger Hochschulabsolvent. Es gibt praktisch keinen Abgeordneten, der in einem handwerklichen Beruf tätig war, als er oder sie gewählt wurde. Nur drei Abgeordnete hatten eine handwerkliche Vergangenheit: Alain Bruneel, ein ehemaliger Arbeiter in einer Textilfabrik; Dino Cinieri, ein Ex-Stahlwerker; und Denis Sommer, ein früherer Peugeot-Arbeiter, der nach seiner Wahl als Lehrer tätig war.
Diese Diskrepanz ist keineswegs neu. In der Geschichte der französischen Nationalversammlung, seit der fünften Republik, hat der Anteil der Arbeiter und Angestellten im privaten Sektor unter den Abgeordneten nie mehr als 10 Prozent betragen. Obwohl in den 1960er und 1970er Jahren ein leichter Anstieg zu verzeichnen war, hat der Anteil seither kontinuierlich abgenommen. Besonders auffällig ist, dass während der Perioden der Linken in der Regierung dieser Anteil nicht höher war als der der Rechten. Trotz gewisser Schwankungen bleibt eines klar: Der Zugang der Arbeiterklasse zur politischen Repräsentation bleibt weiterhin stark begrenzt.
Ein weiteres interessantes Phänomen ist, dass die Mitglieder der Nationalversammlung in Frankreich heute eine „professionelle politische Kaste“ bilden. Wer in nationales Amt strebt, muss oft viele Jahre in der Politik tätig gewesen sein. Die jüngsten Wahlen von 2017 sind eine Ausnahme, die mehr als einen historischen Moment widerspiegeln als eine nachhaltige Veränderung des Systems. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass die politische Erneuerung in Frankreich längst nicht so hoch ist wie in anderen Ländern. Nur etwa 45 Prozent der Abgeordneten sind bei jeder Wahl neu, was im internationalen Vergleich durchaus als hoch gilt – im Gegensatz zu Ländern wie den USA oder Großbritannien, wo der Anteil der neu gewählten Abgeordneten deutlich niedriger ausfällt.
Trotz dieser scheinbaren Erneuerung bleibt die Frage, warum die Arbeiterklasse in den politischen Institutionen so wenig vertreten ist. Liegt es an einem Mangel an geeigneten Kandidaten, die sich aus der Arbeiterklasse zur Wahl stellen? Oder – und das mag unpopulär klingen – liegt es daran, dass die Wähler Arbeiterkandidaten als inkompetent ansehen und lieber mit Führungskräften oder wohlhabenden Unternehmern abstimmen? In den USA etwa kandidierte Donald Trump mit dem Argument, dass sein finanzieller Erfolg ein Beweis für seine Fähigkeit sei, das Land zu führen. Doch Trump hat bei der Bewertung seiner Finanzen gegenüber den Märkten schlecht abgeschnitten. Wenn er beispielsweise sein Vermögen von 200 Millionen Dollar in den 1970er Jahren in ein Immobilien-Indexprodukt investiert hätte, wäre er heute etwa doppelt so reich wie mit seinen realen Investitionen. Dies stellt die Frage, ob Wähler tatsächlich glauben, dass Unternehmer oder Manager besser qualifiziert sind als Arbeiter.
Es stellt sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall ist. In verschiedenen Ländern, wie Großbritannien, Argentinien und den USA, zeigen Umfragen, dass Wähler keine klare Präferenz für Kandidaten aus der Oberschicht gegenüber Arbeitern haben. In Großbritannien und Argentinien gaben Wähler an, dass sie keinen Unterschied zwischen einem Manager und einem Arbeiter sehen, während in den USA eine leichte Präferenz für Arbeiterkandidaten besteht. Wähler glauben nicht, dass Führungskräfte grundsätzlich besser qualifiziert sind, sondern betrachten Arbeiter sogar als fähiger, ihre Anliegen zu teilen.
Wenn also die Arbeiterklasse in politischen Institutionen nicht unterrepräsentiert ist, weil die Wähler dies wünschen, was erklärt dann die anhaltende politische Ausgrenzung? Ein wesentlicher Faktor für dieses Ungleichgewicht liegt im Einfluss von Geld auf den Wahlprozess. In den USA beispielsweise ist es extrem kostspielig, eine Wahlkampagne zu finanzieren, und noch teurer, sie zu gewinnen. Kandidaten aus der Mittelschicht haben es viel leichter, die notwendigen Gelder zu beschaffen, sei es durch private Netzwerke oder Bankkredite. Für Arbeiterkandidaten hingegen ist dies eine unüberwindbare Hürde. Auch in Frankreich, wo es Obergrenzen für Wahlkampfkosten gibt, sorgt die Verfügbarkeit von Geld dafür, dass nur bestimmte soziale Gruppen in der Lage sind, sich politisch zu engagieren.
Die Lösung dieses Problems ist offensichtlich: Es wäre dringend erforderlich, den Einfluss von privatem Kapital in Wahlkämpfen zu begrenzen. In früheren Kapiteln wurde bereits die Notwendigkeit eines echten öffentlichen Finanzierungssystems und eines Verbots privater Spenden oberhalb eines bestimmten Betrags thematisiert. Ein „Demokratie-Bank“ -System, das Kandidaten die gleichen finanziellen Möglichkeiten zur Wahlkampfvorbereitung bietet, könnte eine gleichwertigere Grundlage für alle schaffen und damit die politische Repräsentation von Arbeitergruppen fördern.
Die Kernfrage bleibt jedoch: Was bedeutet diese Unterrepräsentation für die Demokratie? Sie zeigt deutlich, dass nicht nur soziale, sondern auch finanzielle Barrieren im politischen System bestehen, die es einer breiten Schicht der Bevölkerung erschweren, Zugang zu politischen Ämtern zu erhalten. Ein politisches System, das vor allem von den finanziellen Möglichkeiten der Kandidaten bestimmt wird, kann nicht von einer wahren demokratischen Gleichberechtigung sprechen.
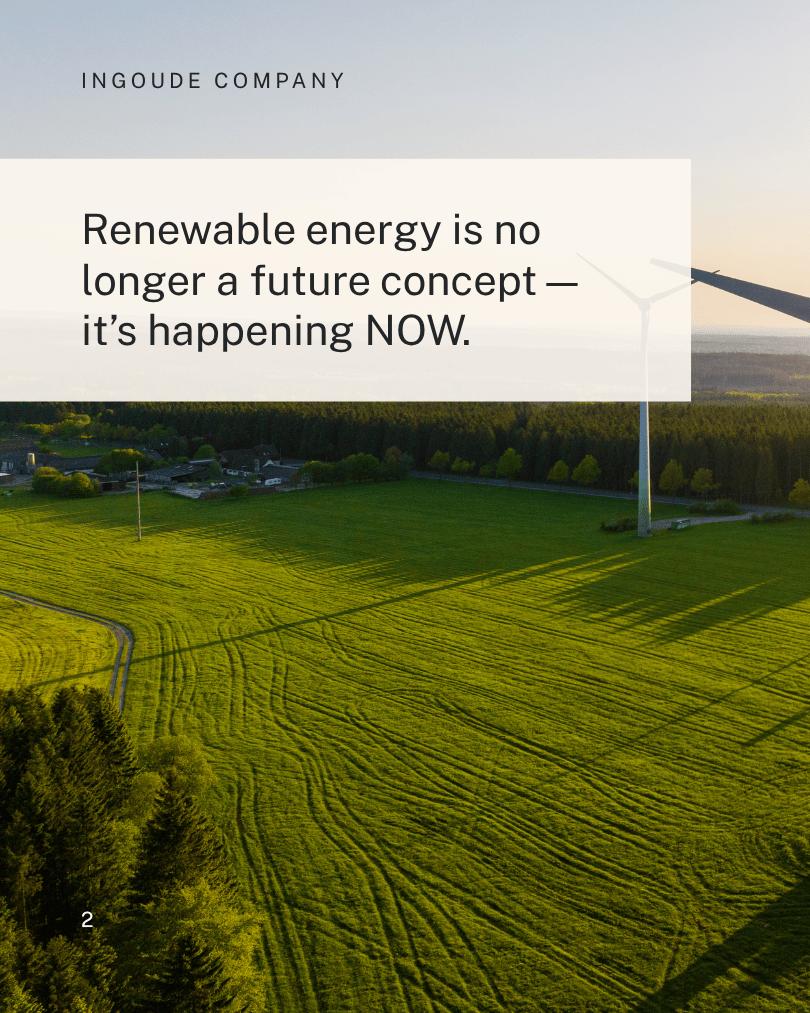

 Deutsch
Deutsch
 Francais
Francais
 Nederlands
Nederlands
 Svenska
Svenska
 Norsk
Norsk
 Dansk
Dansk
 Suomi
Suomi
 Espanol
Espanol
 Italiano
Italiano
 Portugues
Portugues
 Magyar
Magyar
 Polski
Polski
 Cestina
Cestina
 Русский
Русский